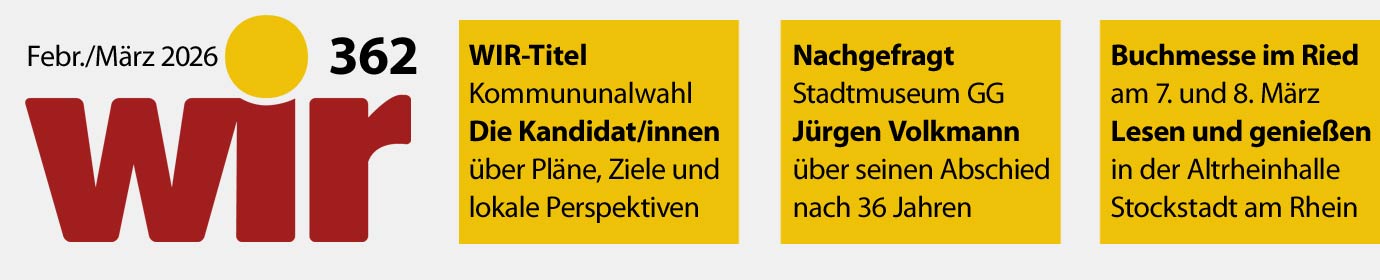Kriegsende in Groß-Gerau

Von Norbert Gröss.
In seinem Buch „Es begann 1936“ hat Norbert H. Gröss, damals 9 Jahre, neben seinen Memoiren auch Auszüge seiner Erlebnisse vor 80 Jahren aufgezeichnet, als die Amerikaner nach Groß-Gerau kamen.
Dass sich an der aktuellen Kriegssituation etwas verändert hatte, merkten wir daran, dass der tagelange Artilleriebeschuss auf Groß-Gerau aus Richtung Oppenheim aufgehört hatte. In der Nacht auf den 24. März überquerten die Amerikaner den Rhein und drangen in Richtung Groß-Gerau vor. Einem schnell zusammengestellten deutschen Truppenverband gelang es tatsächlich, die amerikanischen Truppen etwa 1-2 km von Groß-Gerau in Richtung Wallerstädten zurückzudrängen, dann ging ihn wahrscheinlich die Munition aus, und sie zogen sich in derselben Nacht wieder zurück. Die unerwartete deutsche Offensive, muss für die Amerikaner so überraschend gekommen sein, dass sie bei ihrem scheinbar fluchtartigen Rückzug eine Menge Kriegsmaterial und Militärfahrzeuge zurückließen, von dem wir Kinder damals profitierten
Wir wohnten in der Steinstraße 12 (Stoogass) gegenüber vom Bauern Jacobi, bei dem wir Kinder die letzten Nächte wegen dem Artilleriebeschuss aus Oppenheim im Keller verbrachten. Unser Haus war ein Stockwerk höher. Daher hofften wir, vor den Granaten etwas geschützt zu sein. Nach einer sehr unruhigen Nacht durch Gefechtslärm wurden wir durch laute Motorgeräusche von Militärfahrzeugen, besonders Panzerketten, aufgeschreckt. Da wussten wir, der Feind war da. Uns allen war klar, dass sich nun sehr vieles verändern würde und wir hofften, dass es nicht ganz so schlimm käme, wie es uns aus dem Volksempfänger (Radio) die ganzen Tage über prophezeit worden war: Die Frauen würden vergewaltigt und die Männer massakriert, ohne Rücksicht auf das Alter.
Als nach einer gewissen Zeit nichts geschah, gingen mein älterer Bruder Erwin (12) und ich (9) aus dem Haus in den Hof vom Bauer Jacobi und öffneten vorsichtig die Eingangstor zum Hof. Mein Bruder nahm einen langen Stock setzt auf die Spitze seine Mütze, und schob sie in Kopfhöhe langsam vor die Tür zur Straße. Als nichts geschah, legte ich mich auf den Bauch, um mit einem gewaltigen Kribbeln einen Blick in Richtung Mainzer Straße zu werfen, von der aus der Motorenlärm kam. Da sah ich aus etwa 100 Meter Entfernung meine ersten Amerikaner. Sie gingen im Gänsemarsch in Richtung Stadtmitte und sahen unter ihren Helm aus wie „normale Menschen“. Die Infanterie wurde eskortiert von Panzern sowie Kriegsfahrzeugen, beladen mit Soldaten, und Kanonen. Ich rannte zurück ins Haus und berichtete von meinen Beobachtungen. Unsere Neugier hatte die Angst vor dem Feind verdrängt, und wir wollten die Sache näher untersuchen. Unsere Eltern waren zwar dagegen. Doch im Haus zu sitzen und zu warten was kommt, war auch nicht unsere Art, besonders nicht meine. Nachdem wir die Eltern beruhigt hatten, machten wir noch mal ein Test mit dem Stock und der Mütze am Tor. Als nichts passierte, wagten wir uns vorsichtig auf die Straße und sahen, dass sich die Situation an der Mainzer Straße nicht verändert hatte. Wir gingen dann vorsichtig und ganz dicht an den Häusern entlang in Richtung Mainzer Straße, immer bereit hinter einem Torpfosten in Deckung zu gehen, falls einer mit einem Gewehr auf uns zielen sollte. Nach etwa 30 Metern kamen wir in an die Landwirtschaftsschule, gingen durch den langen Hof, kletterten über die Mauer in den Garten und dann durch die Scheune in den Hof vom Bauern Sperling (hier überlebte ich etwa zwei Jahre später knapp einen Absturz). Diesen Weg ging ich öfters, wenn ich dort im Haus, Hof oder Garten mitarbeitete. Die Familie Sperling wohnte in der Mainzer Straße im Scharfrichterhaus und hatte drei Kinder mit denen meine Schwester und ich öfter zusammen waren. Nachdem wir uns bemerkbar gemacht hatten, öffnete ich langsam das kleine Hoftor zur Mainzer Straße. Meine Brüder blieben etwas im Hintergrund in einer gesicherten Fluchtdistanz zu den Stallungen und zur Scheune. Nach einer gewissen Zeit höchster Anspannung, wich langsam die Angst und das Misstrauen und wir trauten uns raus an die Straße. Die meisten Soldaten beachteten uns gar nicht, ganz wenige schauten uns böse an und machten abfällige Bemerkungen, die wir nicht verstanden. Dann sprachen uns auch einige freundlich an und gaben uns ein paar Geschenke, wie Kekse, Süßigkeiten und Kaugummi (Chewing-Gum), wofür wir uns bedankten. Unser Bruder und Gymnasiast Kurt (14) tat dies auf Englisch. Das kam gut an und er erhielt einige Süßigkeiten mehr, was mich besonders anspornte, diese Sprache schnellstens zu erlernen. Besonders erstaunt waren wir über die vielen schwarzen Soldaten (die man damals noch Neger nannte). Wir kannten sie nur aus Büchern über Afrika. Dass der Krieg gegen viele Länder geführt worden war, wussten wir. Doch Menschen aus Schwarzafrika unter den Amerikanern waren uns neu.
Nach etwa einer halben Stunde zogen wir uns wieder zurück, um über unsere Erlebnisse schnellstens zu Haus zu erzählen. Unser Bericht und die erhaltenen Geschenke erzeugten ungläubiges Erstaunen beim Rest der Familie, doch sie waren sie froh, uns lebendig wieder zu sehen. Danach wurden die Geschenke zuerst bestaunt und dann gegessen, wobei uns das Kaugummi beim Schlucken etwas Probleme machte.
In der Zwischenzeit entsorgten unsere Eltern und Jacobis alles, was mit dem „großen Führer“ in Verbindung gebracht werden könnte, in der Jauchegrube. Vorher hatten sie schon an beiden Häusern ein weißes Betttuch an einer Bohnenstange gut sichtbar aus dem Fenster gehängt, was auch alle anderen Nachbarn taten, als Zeichen der Kapitulation. Das heißt, dass wir keinen Widerstand leisten und uns ergeben. Auch ich warf zuhause mein nun arbeitslos gewordenes Schwert (siehe WIR-Ausgabe 350) in die Jauchegrube. Eine körperliche Auseinandersetzung „Mann gegen Mann“ war in der aktuellen Situation nicht zu erwarten und das Risiko als Besitzer einer Vernichtungswaffe wollte ich auch nicht eingehen.
Danach begann, besonders für uns Kinder, eine relativ schöne Zeit. Wir wurden nicht mehr durch Sirenengeheul mitten in der Nacht aus den Betten getrieben und konnten endlich, nach langen Monaten, wieder spannungslos durchschlafen. Auch das zurückgelassene Kriegsmaterial von beiden Kontrahenten, besonders der Inhalt der Militärfahrzeuge waren zum Teil sehr ergiebige Fundgruben.
Davon profitierten besonders wir Kinder, denn die wenigen noch verbliebenen deutschen Männer trauten sich in den ersten Tagen noch nicht so weit aus ihren Häusern. Auch gab es für die Erwachsenen eine zeitlich begrenzte Ausgangssperre, und es war für sie Pflicht immer einen Personalausweis dabei zu haben. Deshalb hing an jeder Ausgangstür der Straße eine schriftliche Warnung. „Geh ohne Pass nicht auf die Gass“.